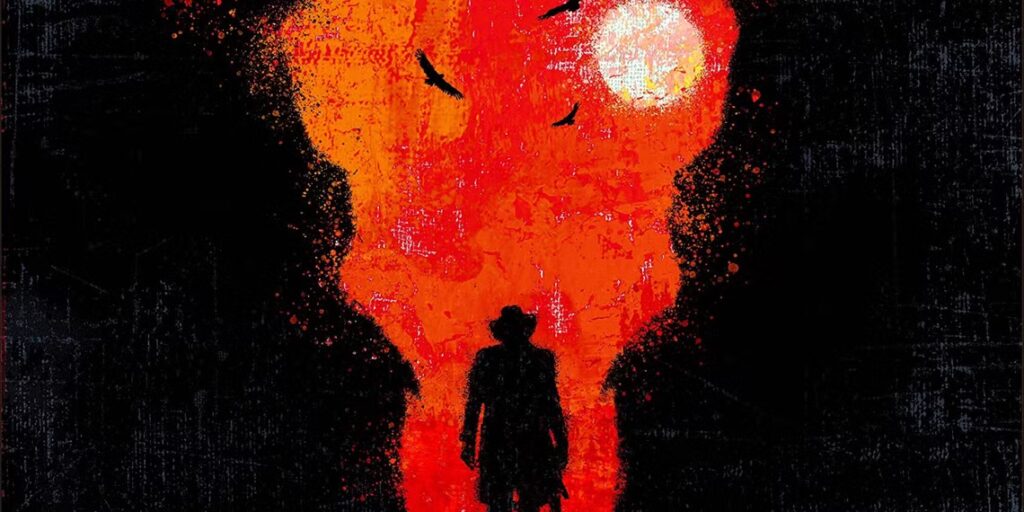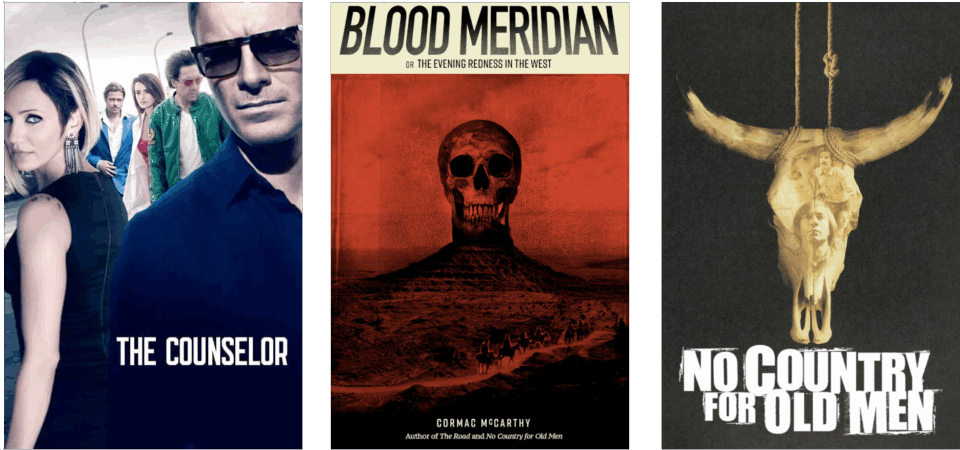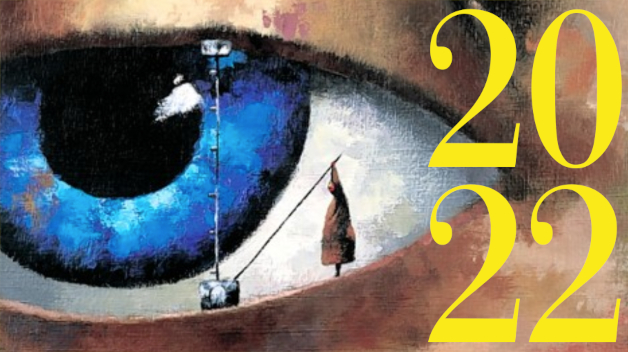Eigentlich sollte das hier ein Jahresrückblick werden, aber nun ist es ein Text über mich und meine popkulturelle Überforderung. Fluchtversuche und Entzug inklusive.*
*ein paar Empfehlungen gibt es aber natürlich trotzdem.
Vermutlich ist es keine besonders kontroverse Meinung, die Tage zwischen den Jahren für einige der schönsten in fast jedem Jahr zu halten. Die Weichnachtstage sind vorbei, man fühlt sich vielleicht etwas leer, etwas melancholisch, post shakey times sad. Aber irgendwo auch glücklich. Die Gesellschaft steht zwar nicht still, wird aber doch um ein, zwei Gänge heruntergefahren. Und diejenigen, die das Glück haben, sich in den wenigen Tagen bis zum Jahreswechsel mal nicht am Arbeitsplatz vernutzen lassen zu müssen, haben vor allem eines: Ein kleinwenig Zeit.
Schon seit Jahren versuche ich mir diese Zeit zu nehmen. Für mich selbst, für etwas Seelen-Inventur, ein kleines bisschen Resümee-Ziehen, für die ungelesenen Bücher, eingepackten Filme, für die Wahlfamilie, sprich Freund*innen, die in diesen Tagen meist auch etwas mehr Zeit haben als sonst so. Für mich fühlt sich das nach Freiheit an. Nicht nur von den ganzen Terminen, dem Immer-ist-irgendwas, dieser „zermürbenden Tortur zwischen Langeweile und Hektik, Überstunden und Arbeitslosigkeit“ (Dietmar Dath), die wir Gegenwart nennen, sondern auch von der popkulturellen Überforderung, die mich anstrengt und überfordert. Einfach wirklich mal freier sein in dem Sinne, dass man tatsächlich mehr tun und denken kann, als das im vereinsamenden Strom der Informationsüberflutung und Arbeitszyklen sonst möglich ist.
Das mag sich für andere nicht so anfühlen und vielleicht auch irgendwo ein Privileg sein, aber so sieht es für mich aus. Und andere Perspektiven gibt es auf diesem kleinen Blog nicht.
Pop Culture Doomscrolling
2022 war für mich persönlich etwas besser sein Vorgänger. Sprich: Die Probleme und Sorgenquellen waren etwas schönere, vielleicht waren es sogar ein paar weniger (ganz persönlich betrachtet und die Weltlage mal ausgeklammert). Wirklich gut geht es mir aber nicht. Aber das gilt aktuell irgendwo für fast alle, glaube ich. Richtig glücklich scheint hier niemand zu sein, ein paar merken es nur nicht mehr. Unterm Strich waren wir alle viel zu müde. Trotzdem: Die Krisen im letzten Jahr waren für mich selbst existenzieller, sprich: unzählige Krankhausbesuche, kaputte Beziehungen, verblassende Freundschaften. Dieses Jahr hatte ich nun das Privileg, die Problemfelder wieder mehr in mich hinein verschieben zu können, die externen Schocks blieben aus. Möglichkeit also, sich zu fragen, wieso das alles die ganze Zeit über so verdammt anstrengend sein muss. Und damit meine ich auch mein Verhältnis zur Kunst und zur Popkultur. Also zu dem ganzen Zeugs, dass mir die Welt bedeutet und ziemlich viel von dem ist, was ich als Ich so bin.
Schon lange hat sich genau hier eine diffuse Form von Unzufriedenheit breitgemacht. Schlimmer noch: von Gleichgültigkeit. Das Gefühl, dass ich durch die kulturellen Neuerscheinungen der Woche genauso desinteressiert hindurchbrowse, wie durch die Twitter-Feeds, in denen genau diese Kunstwerke in Überlichtgeschwindigkeit diskutiert und wieder verworfen werden. In diesem typischen distanziert-coolen, vermemeten und brutal-ironischen Sound, den ich schon lange kaum noch ertragen kann und der nichts Aufrichtiges, Wahrhaftiges oder Schönes in sich trägt und keinen Zentimeter Platz lässt für irgendwelche Formen von Verletzlichkeit und Empathie. Alles ist witzig, niemand hat Spaß. Ironie als der Gesang eines Vogels, der seinen Käfig zu lieben gelernt hat. Der ganze Distinktionsscheiß. Fuck off. Wo waren wir?
Klar: Das alles ist Twitter. Da bin ich heutzutage (früher war irgendwie weniger unerträglich in meiner Timeline) nicht mehr so richtig freiwillig, sondern eher aus den gleichen Gründen, aus denen ich 200 Mal am Tag auf mein Handy schaue und mich so verhalte, als wäre es wirklich wichtig was diese Woche in der fucking Tagesschau gedropped wird. Also irgendwas mit Konditionierung, Dopaminausschüttung und vor allem: Zwanghaftem Up-to-Date-sein.
(Nicht mehr) Verstehen durch Pop
Pop und Kultur waren für mich nicht nur (aber natürlich auch) Unterhaltung und Ästhetik, sondern immer auch Wege, etwas mehr von unserer Gesellschaft und Gegenwart zu verstehen. Klar, so gesprochen ist das irgendwo eine soziologische und ideologiekritische Trivialität, aber das meine ich hier eigentlich eher nicht. Oder zumindest nicht nur das. Ich ziele da auch auf eine viel intuitivere, affektivere Ebene jenseits der Akademie ab. Popkultur hat mir immer geholfen eine interessantere, intensivere und irgendwo auch schönere Verbindung herzustellen zu der Zeit in der und den Menschen mit denen ich hier zusammen existiere. Das ist auch der Grund dafür, dass ich in mir dieses starke Bedürfnis verspüre „mitzuhalten“. Zu wissen, was im Pop grad passiert, was auf heute gerade Twitter zirkuliert, welche Alben am Freitag released werden, das alles. Wenig bereitet mir ganz persönlich und individuell mehr Grusel als all diese Mittzwanziger-Menschen in meinem Alter, die gerade anfangen stellenweise die Verbindungen zur Gegenwartskultur zu kappen. Die nur noch wenige Schritte entfernt sind von diesem „Früher war alles besser und interessanter“-Vibe, der ausschließlich von Personen ausgestrahlt wird, die irgendwann mal unterbewusst beschlossen haben: That’s it. Diese zehn Bands und acht Alben bis zum Tod. Die Zukunft als Rückzug in eine endlose Verlängerung eines bestimmten Punktes in der Gegenwart. The Horror.
In unserer sich weiter und weiter beschleunigenden Gegenwart ist diese Veranlagung Up-to-Date zu bleiben – etwas, das ich an mir grundsätzlich eher mag – immer mehr zu meinem Problem geworden. Gefühlt geht es ja vielen so. Viele leiden, fühlen sich von dem Zwang erdrückt, immer und überall dabei sein zu müssen. Jeden Tag gibt es einen neuen „Song des Jahres“, einen neuen Mikrotrend auf Tik Tok, eine neue ganze okaye soon-to-be-forgotten Serie, die irgendwie und irgendwo wochenlang durch die Feeds zirkuliert. Tik Tok, Twitter, Letterboxd, der ganze Quatsch. Das alles ist von der Plattforminfrastruktur natürlich genauso gebaut, dass es jede kleine Saat von Fomo, die irgendwo mal angelegt war, zu prächtig sprießenden Dschungeln hochkultiviert. I know, Medienanalyse like it’s 2014, aber so richtig mit beschäftigen und ein bisschen reflektieren, das ging bei mir erst in 2022 mal so wirklich – auch wenn diese Dynamiken meine Liebe zu Kunst und Kultur natürlich schon seit langem mit kleinen Rissen versehen haben. 2022 (oder besser gesagt: in den letzten Monaten des Jahres) wurde dann aus vielen kleinen Rissen ein Bruch. Leicht verzweifelte Rettungsmaßnahmen inklusive.
Und Entzug. Das ist eigentlich das passende Wort. Denn so richtig bewusste Entscheidungen treffe ich nur noch selten, vieles fühlt sich eher suchtgeleitet an. Fast alles wird mir von Algorithmen serviert und in einer Fülle, dass selbst die schönsten Gerichte auf dem Tisch irgendwann nur Gefühle von Überfressen und Übelkeit auslösen. Es ist zu viel. Dabei waren Begegnungen mit Kunst für mich eigentlich immer dann besonders schön und erfüllend, wenn sie spontan, unerwartet und vielleicht sogar etwas zufällig stattfanden. Kaum etwas löst in diesem Dschungel aus Signalen heute noch ein Gefühl aus wie damals, als ich vor Jahren irgendwann mal – Scorsese-Fan der ich war – ins Blinde hinein eine Komplettbox von Die Sopranos aus dem Secondladen-Laden mit nach Hause genommen habe (weil „bestimmt irgendwas Cooles mit Mafia“) und meine Welt danach nicht mehr die gleiche war. Hat sich früher vieles für mich spontan, organisch und aus meinem Eigenantrieb heraus ergeben, ist mein Gefühl heute – in der Liebe wie in der Kunst – jeden Tag und komplett algorithmisiert in mittelmäßige Blind-Dates hineinmanövriert zu werden – von Unternehmen, deren Profit davon abhängt, möglichst viele Leute möglichst oft algorithmisiert auf mittelmäßige Blind-Dates zu schicken. Es ist so ermüdend.
Aufhören mitzuhalten
Inzwischen habe ich alle meine Streaming-Services gekündigt und stattdessen einen vernünftigen VPN-Client abonniert. Mein Twitter-Feed ist so stark ausgedünnt, dass ich dort tatsächlich wieder interessante Dinge finde und mein Gehirn auch noch die Kapazität hat, um damit irgendwas anzufangen. Musik höre ich am liebsten mit meinem IPod-Classic, kuratiert und mit einem Gerät, das nur eine Funktion hat und mich nicht noch mit 7 Pop-Up-Nachrichten dazu verleitet, irgendwas anderes zu tun während ich grad versuche meine liebe zu Popmusik zurück zu erkämpfen. Dass ich nun aufhöre, mich mit dem zu beschäftigen, was in meiner Zeit passiert, und den erschöpften Rückzug antrete, heißt all das aber genau nicht. Hoffentlich. Für mich fühlt es sich sowieso anders an. Wenn ich 400 neue Alben im Jahr höre, 100 Filme sehe, 40 Serien schaue, dann ist das für mich keine intensive Beschäftigung mit Gegenwartskultur, sondern der sichere Weg, mich mit überhaupt nichts mehr so wirklich beschäftigten. Vielleicht werden die Spotify-Wrappes weniger angebertauglich, sehen die Letterboxd-Recaps weniger fancy aus. I don’t know. In Wahrheit kann sowieso niemand 100 Bücher im Jahr lesen, auch wenn das auf Goodreads steht – also zumindest nicht wirklich lesen. Für jeden langen Text über ein Album, dass jemandem wirklich etwas bedeutet, verbrenne ich hunderte immergleiche Year-End-Lists mit ihren 50 oder 100 Einträgen, die nichts als Infodumping sind. Ich will das alles nicht mehr lesen. Will nicht mehr das Gefühl haben, dass die Beschäftigung mit Kunst sich für mich anfühlt wie ein Game, das es nicht zu verlieren gilt.
Escape exhaustion, restart excitement
Daher ist dieser Fluchtversuch eigentlich auch gar keiner, sondern eher ein Weg zurück, um endlich wieder überhaupt noch – stay in the meme – irgendwas zu spüren. Das Resultat ist nicht Kontaktverlust, sondern die sich für mich extrem wohltuend anfühlende Entwicklung, dass ich zu den besten und schönsten Kunstwerken des Jahres überhaupt mal wieder wirklich was zu sagen hätte und mir der Krams, in den ich eintauche, endlich wieder tatsächlich etwas bedeutet.
Natürlich kann ich dir sagen, warum das neue Album von Rosalía, dieses Werk, das in kreativer Hinsicht über alles hinaus geht, das ich in den letzten Jahren gehört habe, so verdammt großartig ist. Ich kann dir sagen, dass das im wortwörtlichen Sinne Weltmusik ist – 1000 Einflüsse, 1000 Ideen, 1000 Sounds – und dass dabei immer alles im Fluss bleibt. Und dass Genregrenzen eingesargt werden und man da die beste Produktion und den schönsten Gesang der Welt finden kann.
Aber genauso kann ich dir auf 1000 neue Arten erklären (keine Sorge, ich tue es nicht), wieso es auch bis heute nie eine bessere Serie, als die bereits gedroppten Sopranos gegeben hat (I know, ein sehr origineller Take, aber who cares?). Denn die habe ich in diesem Jahr, losgelöst von allen Diskursen und Aktualitätszwängen, auch nochmal in Ruhe gesehen. Dazu habe ich mir das wunderbare und allen, die auch irgendwie mit gutem Culture Writing connecten können, hiermit empfohlene Buch The Sopranos Sessions von Alan Sepinwall und Matt Zoller Seitz gelesen. Darin gibt es superspannende Interviews mit David Chase, vor allem aber auch tiefe Analysen zu jeder einzelnen Episode, die das genaue Gegenteil sind von all den unsäglichen, schlecht geschriebenen Recaps, die man zu jeder Mistserie über das ganze Internet verteilt findet und die vielleicht so symptomatisch sind für die Probleme, die ich hier umkreise, wie kaum etwas anderes. Nach jeder Episode habe ich das passende Kapitel gelesen, mir Notizen gemacht, versucht Verbindungen herzustellen. Es war mit die schönste Zeit, die ich in diesem Jahr popkulturell erlebt habe.
Am wichtigsten aber sind vielleicht sogar die Dinge, die ich vorüberziehen lasse. Nichts stimmt mich optimistischer als das, was ich beruhigt verpasst habe. Ich kann es kaum erwarten euch nie, aber auch wirklich niemals erklären zu können, was in Avatar 2: Way of the Water oder Amsterdam passiert und ob das neue Album von Harry Styles irgendetwas Interessantes in sich trägt.
Das wars. Wenn irgendwer bis hierhin durchgehalten hat: Glückwunsch, ich hoffe, es hat dir irgendwas gebracht. Vermutlich ist wenig bis gar nichts an diesem Text wirklich originell oder neu oder State of the Art-Diskurs. Darum soll es hier ohnehin nicht gehen, das ist nur mein kleiner Blog, die redaktionell betreuten und von äußeren Zwängen und Konventionen geformten Texte veröffentliche ich lieber weiterhin in anderen Medien. Aber vielleicht fühlt es sich ja auch ohne den ganz großen Erkenntnisgewinn gut an, wenn man sieht und liest, dass man nicht ganz allein durchdreht, sondern es anderen oft ganz genauso geht. Und man nichts dafür kann. Zumindest mir geht es oft so.
Ich wünsche euch ein schönes Jahr 2023. Vielleicht ja mit einigen meiner kleinen Empfehlungen aus diesem Jahr, die jetzt noch folgen. Denn das ist für mich Kultur und Kunst, die wirklich zählt. Die mein Jahr und Sein bereichert hat, wie kaum etwas anderes, und die auch im nächsten Jahr künstlerisch relevant sein wird. Auch dann, wenn sich mit ihr in den aktuellen Grabenkämpfen auf Twitter, diesem Laden, „der zu nichts anderem da ist als zur suchterzeugenden Fabrikation, Vervielfältigung und Weiterverarbeitung finster-klebriger Erregungsschmiere“ (Dietmar Dath), keine großen Distinktionssiege mehr erreichen lassen.
Hoffentlich geht es euch allen ungefähr so gut, wie das aktuell eben so möglich ist.